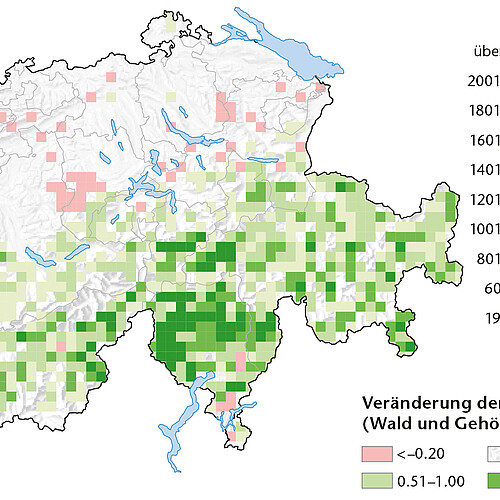- Perspektive
Peter Wohlleben, ein zeitgenössischer Druide?
01.07.2025

Essay
Abstract
Der Autor Peter Wohlleben behauptet in seinen Büchern, dass Bäume intelligent und sensibel seien, dass sie fühlen und leiden würden. Das widerspricht zwar den wissenschaftlichen Fakten, fällt aber bei vielen Leserinnen und Lesern auf fruchtbaren Boden. Was bedeutet das für die zukünftige Waldbewirtschaftung? Und wie soll die Forstbranche auf diesen Hype reagieren? Das Essay endet mit zwei Aufgaben an die Forstbranche, um die Kommunikation nach innen und mit der breiten Öffentlichkeit nach aussen voranzutreiben.
Schweiz Z Forstwesen 176 (4): 215–219.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0215
* Rebbergstrasse 45, CH-8049 Zürich, E-Mail domont@sylvacom.ch
Wie lange noch werden Forstleute Holz aus den Wäldern nutzen können, wenn eine aktive Minderheit in der Bevölkerung die Meinung verbreitet, dass Bäume intelligent und sensibel seien, dass sie fühlen und leiden würden? Ein Auslöser dieser Frage ist der epochale Verkaufserfolg der Bücher von Peter Wohlleben vor allem ab 2015 mit seinem bekanntesten Werk «Das geheimnisvolle Leben der Bäume» (Wohlleben 2015).1 Seine Bücher besetzen seit Jahren einen sehr sichtbaren Anteil der Regale «Natur – Wald – Bäume» der Buchhandlungen, in über 40 Sprachen rund um den Globus. Das Vertrauen, das Leserinnen und Leser gegenüber Autoren wie Wohlleben zeigen, bestätigt zunächst, dass Wald und Bäume in unserer westlichen Welt eine enorme Projektionsfläche für gesellschaftliche Sehnsüchte und Sorgen geworden sind. Es wird oft von Ersatzreligion gesprochen, die bewusst oder unbewusst die Natur als allwissende Ganzheit und den Menschen als untaugliches Wesen betrachtet. Dies passt auch zur bereits lang andauernden Abkehr von bisherigen Autoritätsformen. Demnach wäre Wohlleben ein Vertreter einer neuen Druidengeneration und Interpret einer Natur, die vergöttlicht wird oder zumindest auf eine menschliche Ebene gestellt wird.
Vom Faktum zur ideologischen Interpretation
Der Autor ist zweifelsohne ein begnadeter Erzähler, hat Freude an der Vermittlung der eigenen Sichtweise, nicht nur zu Wald und Bäumen, sondern auch zur Umwelt und zu einer Vielzahl von anderen Fachbereichen. Er kritisiert nicht nur «die Forstwirtschaft», sondern auch die Entwicklung der Gesellschaft, namentlich die Überbevölkerung der Erde (Wohlleben 2010). Wohlleben formuliert viele interessante und korrekte Beobachtungen zu Wald und Bäumen. Nur: Die Interpretationen, suggestiven Erklärungen, Andeutungen, die systematische Zuteilung von höheren menschlichen Eigenschaften an Bäume (Anthropomorphismus) sowie viele weitere rhetorische Instrumente wie Übertreibung, einseitige Beleuchtung oder Generalisierung werfen Fragen auf. Es handelt sich schliesslich nicht mehr um Wissenstransfer, sondern eher um eine Instrumentalisierung des Wissens. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weisen zudem auch auf falsche Fachinformationen hin.

Folgende zwei Beispiele illustrieren stellvertretend für viele andere den Übergang zwischen Fakten und falscher Information.
In einem Interview beim deutschen Sender SWR2 (2021) lässt die Moderatorin ihren Gast über die neuen, dramatischen Überschwemmungen in Deutschland frei referieren. Wohlleben kritisiert mit ruhiger, freundlicher Stimme die modernen Forstmaschinen im Wald: Diese schweren Erntemaschinen würden den Waldboden durch Verdichtung zerstören (Verallgemeinerung) und zusätzlich Rillen schaffen, in denen das Wasser abfliesst und in der Ebene zu Überschwemmungen führt (falsche Schlussfolgerung). Dagegen würden die von ihm schonend bewirtschafteten oder nicht genutzten Buchenwälder «alles einsickern lassen».2 (Übertreibung). Von einer lokalen Beobachtung (beschädigter Boden im Falle von nicht fachgerecht eingesetzten Geräten) werden also generelle, landesweite Zerstörungen abgeleitet. Unerwähnt bleibt zudem das forstliche Allgemeinwissen, wonach der Wald den globalen Abfluss und die Überschwemmungen nach starken Niederschlägen nur sehr begrenzt beeinflussen kann.
Wohl zu den bekanntesten Narrativen Wohllebens gehört die Fürsorge der Buchen-Mutterbäume für ihre Sprösslinge. Basierend auf Publikationen der kanadischen Forscherin Suzanne Sigmard3 über Douglasien, wiederholt der Autor in Büchern und zahlreichen Interviews, dass die Buchen-Mutterbäume ihre Sprösslinge fürsorglich ernähren («stillen») und ihre eigene «Kinder» bevorzugen würden. Sigmard schreibt, dass die Mutterdouglasien sogar ihre Wurzelstruktur ändern, um Platz für Babybäume zu schaffen.
Schon Grundkenntnisse des Waldökosystems offenbaren, dass eine Buche keine fürsorgliche, «stillende Mutter» sein kann. Vielmehr liegt die Umkehrung der Metapher auf der Hand: Buchen als «mehrfache Kindermörderinnen», die jedes Jahr Tausende ihrer Sprösslinge, ihre «Babys», unter ihrem dichten Schatten qualvoll ersticken lassen.
Die grosse Mehrheit der Bevölkerung hat aber nicht die Möglichkeit, auf naturwissenschaftliche Grundkenntnisse zurückzugreifen. Sie hat Vertrauen in gefeierte Autoren, sofern deren Botschaften eigene Werte bestätigen oder einen Nerv der Zeit treffen. «Mutterbaum» wird auch von Forstleuten metaphorisch gebraucht, bei Wohlleben wird der Ausdruck wirkungsvoll vermenschlicht.
Langwierige Beweisführung
Einige engagierte Wissenschaftler haben sich die Mühe genommen, gewisse Behauptungen von Wohlleben zu evaluieren und zu widersprechen. David Robinson hat mit 35 anderen Forschenden in einer detaillierten Analyse gezeigt, dass die «Ernährung» (Transfer von C) vom Mutterbaum zu den Sprösslingen in so winzigen Mengen geschieht, dass der «Transfer» irrelevant ist und dass diese Spuren auch nicht bevorzugt zu ihrem eigenen Nachwuchs übergehen (Robinson et al 2024).4
Dabei ist die wissenschaftliche Beweisführung gegen falsche Behauptungen arbeitsintensiv und verlangt meistens Spezialwissen aus mehreren Forschungsbereichen. Die Sprache der Forschenden und von Fachleuten im Allgemeinen ist in der Regel vorsichtig und versteckt die Unsicherheiten nicht – im Gegensatz zu vereinfachenden Behauptungen, die das Publikum schnell und einfach aufnehmen kann.

Es liegt zudem in der Natur der Dinge, dass ein Beweis für die Nicht-Existenz einer Sachlage grundsätzlich langwierig ist. Der touristische Loch-Ness-Mythos in Schottland zeigt seit Jahrzehnten beispielhaft, dass erwünschte Narrative und Legenden auch dann eine hohe Resilienz gegenüber Fakten behalten, wenn Letztere breit untermauert sind.5 Auch Historikerinnen und Historiker wissen um die Bedeutung von Legenden als Erklärung oder gar Verklärung der Vergangenheit. So sagt Volker Reinhardt: «Die Menschen brauchen das, weil wir uns im Fluss der Zeit vergewissern und verorten. Diese Art Geschichte ist eine Art Therapie für die Gegenwart.» 6
Auch akademisch ausgebildete, aber weniger naturwissenschaftlich informierte Personen können auf die Behauptungen und Interpretationen Wohllebens positiv reagieren. Sie schenken dem Buch hohe Relevanz, betrachten es als Offenbarung und glauben, bisher unbekannte Fakten entdeckt zu haben. Es entstehen sogenannte Verschwörungstheorien, nach denen die heutige «Obrigkeit» (Politik, Wissenschaft, Wirtschaft) die Wahrheit verstecken würde und nun zum Glück mutige Autoren die Realität aufzeigen würden.
Wie erklärt sich der Erfolg?
Aber wie erklärt sich der Erfolg von Wohllebens Buch? Für Christian Schröder hat das Buch den Zeitgeist getroffen, in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo vieles als nicht funktionierend wahrgenommen wird. «Und dann kommt ein Förster und erzählt uns von einem funktionierenden, guten System, in dem alle sich gegenseitig helfen und sich stützen, und erzählt das auch noch in einer niedlichen Sprache. Das alles erweckt so etwas wie Sehnsucht in uns nach diesem grossen Funktionieren der Natur.»2
So könnten «fürsorgliche Bäume» möglicherweise das Spiegelbild eines tieferen Bedürfnisses in unserer zunehmend individualistischen, anonymen Gesellschaft sein. Zudem scheint heute die Natur zunehmend als «das Gute» und der Mensch als «das Böse» zu gelten. Da ist das Interesse nicht sehr gross, Fakten von Wunschdenken zu trennen.7
Etwas einfacher und grundsätzlicher erinnert Gérald Bronner8 daran, dass der Mensch lieber komfortable Argumente als wahre Informationen sucht. Die «intellektuelle Faulheit», die ständigen «Kosten-Nutzen-Abwägungen» unserer menschlichen Gehirne machen das Wahrscheinliche oft attraktiver als das Wahre. Es braucht deshalb eine Anstrengung, um Narrativen zu widerstehen, die kognitiv oder emotional gefallen.
Wohlleben bekommt auch argumentative Hilfe durch Wissenschaftlerinnen, die seit einigen Jahren versuchen, ein Fach Pflanzenneurobiologie zu etablieren. Das passt zur anhaltenden Diskussion, ob auch Roboter dank KI vielleicht beseelt seien. Die allermeisten Pflanzenbiologinnen kritisieren aber den Begriff Pflanzenneurobiologie, der auf der Annahme basiert, Pflanzen seien Tieren ähnlich. Sie sind auch mit der Bezeichnung «Intelligenz» bei Pflanzen sehr vorsichtig und verlangen sowohl Klarheit als auch Aufklärung.9
Parallel zum Zuwachs an gesellschaftlicher Sensibilität für Bäume, die sich seit Jahrzehnten global entwickelt hat (u.a. im Zug der Tropenwälder-Problematik), ist logischerweise auch das Interesse der Medien gestiegen. Diese leben von der Aufmerksamkeit ihrer Kundschaft. Diese beiden Aspekte fördern sich gegenseitig. Viele Medien interessieren sich für Emotionen, für Konflikte und für alles, was neu, selten oder dramatisch wirkt. Sie tragen zwar juristisch eine Verantwortung für die Wahrhaftigkeit der Information, nicht unbedingt aber für die Wahrheit.10
Wohlleben wurde ab 2015 von den meisten Medien wohlwollend besprochen und als Fachmann gefeiert. Der Autor sagt von sich, dass er vom Erfolg überrascht wurde. Nur wenige Medien haben sich kritisch zu Wohlleben geäussert, so wie 2018 die NZZ: «Es fällt auf: Sobald man von botanischen Erinnerungen, Warn- und Hilferufen, Schmerzreaktionen und dergleichen spricht, sind ein paar Gänsefüsschen zu setzen. Denn die Tendenz, unter der Hand irreführende anthropomorphe Analogien in die Sprache über die Pflanzen einzuschmuggeln, ist endemisch.»11
Wie auf Wohlleben reagieren?
Die Erfolge mag man Autor, Verlag und Buchhandlungen gönnen. Was bedeutet aber dieser Erfolg für die längerfristige Definition von «guter Waldbewirtschaftung»? Wird das Modell der nachhaltigen Entwicklung noch vertreten? Nach der UNO-Klimakonferenz von Rio (1991) galt es, die Wirtschaft als gleichberechtigt mit Gesellschaft und Umwelt zu betrachten. Umweltschutz (z.B. CO2-Speicherung im Holz) scheint aber heute die Öffentlichkeit weniger zu interessieren als Naturschutz, also die allgegenwärtige Biodiversität. Dass die Forstbranche allein Gegensteuer geben kann, ist zu bezweifeln, haben wir es doch mit einer breiten gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Wo aber führt die Reise hin, wenn Bürgerinnen und Bürger immer mehr überzeugt werden, dass «gute Natur»12 vor dem «bösen Menschen» immer mehr Schutz braucht? Diese komplexe Frage würde es verdienen, im Rahmen eines wirklich globalen Nachhaltigkeitskonzepts breit diskutiert zu werden. Da kann die forstliche Welt mit viel Kompetenz mitmachen. Noch dringender stellt sich die Frage der Aufklärung: Wird die Kritik an der (wissenschaftlichen) Vernunft und am «Anthropozentrismus» die damit verbundene Relativierung vom Wissen («Die Wissenschaft ist nicht alles») Platz für esoterisch orientierte Gesetzgebungen schaffen?
Und wie reagiert die Forstbranche?
Einige deutsche Wissenschaftler haben wie oben erwähnt die Narrative um die Waldgeheimnisse ernsthaft analysiert (Robinson et al 2024, Halbe ).13 Ansonsten haben forstliche Kreise die Bücher von Wohlleben bisher kaum diskutiert. Man findet zwar einige interessante und kritische Kommentare von Fachleuten. Die Stimmung ist eher entspannt: Der Autor übertreibe, die anthropomorphischen Reflexe seien poetisch bis lächerlich.
In der Schweiz hat die Forstpresse bisher nicht reagiert. Es hiess, die Inhalte seien so abstrus, dass man sie problemlos ignorieren könne. Die Sympathie für Wohllebens Interpretationen ist zwar oft gekoppelt an esoterische oder wissenschaftskritische Ansichten. Trotzdem ist sein Erfolg ernst zu nehmen. Er unterstreicht, wie wichtig der Dialog von Fachleuten mit ihren diversen Öffentlichkeiten ist. Politisch ausgedrückt: Auch ein falsch informierter Mensch hat einen gültigen Stimmausweis.
Folgende Überlegungen zur Öffentlichkeitsarbeit der Forstbranche sind als Anregung und Einladung zur Diskussion zu verstehen.
- Aufgabe: Stärkung der Kommunikationskompetenz nach innen Die forstlichen Institutionen (Forschung, Verwaltung, Bildung, Waldeigentum) haben die nötigen Ressourcen, um nach innen die Kompetenzen der forstlichen Akteure im Bereich Kommunikation zu verbessern. Es geht eben nicht nur um typisch forstliche Themen (z.B. Waldbau, Klima, Holznutzung, Biodiversität). Zentral ist die Erklärung des gesellschaftlichen Wandels und die Vermittlung eines Minimums an Vokabular im Bereich Kommunikation, Soziologie und Psychologie. Wer das Vorgehen eines Autors wie Wohlleben nicht nüchtern beschreiben kann, wird kaum sachlich kommunizieren und andere überzeugen können. Die Ausbildungsstätten im Bereich Wald sollten dem Kommunikationsbereich eine viel höhere Priorität einräumen als bisher und dafür fachliche Details in Lerninhalten reduzieren.
- Aufgabe: An der strategischen Kommunikation nach aussen arbeiten Unter den vielen Zielgruppen seien hier kurz die Medien erwähnt (Tagespresse, Fachzeitschriften, Publikumszeitschriften, soziale Medien). Die forstlichen Institutionen haben nicht die Ressourcen, um allein ein Gegennarrativ zu den aktuellen esoterischen Meinungen zu verbreiten. Diese beziehen sich auf viele weitere Bereiche als die Natur wie auf die Gesundheit, die Ernährung, die Erziehung oder den Tierschutz. Hier scheint aber im Einzelfall der erwähnte Ansatz von Ammer pragmatisch und erfolgreich zu sein: mit Medien direkt und konstruktiv in Kontakt treten, wenn die Qualität ihrer Information zu wünschen übriglässt. Ganz allgemein gilt auch: Mehr aktive Öffentlichkeitsarbeit auf lokaler und nationaler Ebene tut Not. Dabei sollen Forstleute auch zeigen, dass sie Gefühle haben. Sie sollen ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen. Und auch bei den Medien sind Verbesserungen nötig: Man sieht am Beispiel Wohlleben deutlich, dass Wissenschaftsjournalisten und -journalistinnen schmerzhaft fehlen – dies wird in Zeiten von KI und knapper Zeit noch stärker ins Gewicht fallen.
Eingereicht: 16. November 2024, akzeptiert (ohne Review): 14. April 2025
Fussnoten
Titel und Inhalt lehnen sich an den Bestseller «Das geheime Leben der Pflanzen» von Peter Tomkins und Christopher Bird (1973). Spätere Auflagen erhielten den Untertitel «A Fascinating Account of the Physical, Emotional and Spiritual Relations Between Plants and Man».
Interview «Der Wald des Peter Wohlleben – Nur Wunsch oder Wirklichkeit?» von Brigitte Schulz mit Peter Wohlleben. 25. August 2021. www.swr.de/swrkultur/wissen/der-wald-des-peter-wohlleben-nur-wunsch-oder-wirklichkeit-100.html, dazu Manuskript zur Sendung mit kontradiktorischem Gespräch mit Christian Ammer, Pierre Ibisch, Christian Schröder, Torben Halbe.
Simard S (2021) Finding the Mother Tree. Penguin Random House. Deutsch: Die Weisheit der Wälder. Auf der Suche nach dem Mutterbaum, 2022. Siehe die Kritik von Robinson et al (2024) und Wikipedia de.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Simard
Robinson D et al (2024) Auszug: “(…) the author of this book, ascribes to plants (in this case trees) a number of human characteristics: feeling pain, being happy and caring for other trees, being able to communicate with other trees, and being capable of creating strategies for the benefit of the group. These are hallmarks of conscious organisms, for which there is zero credible evidence.” Bereits 1999 publizierte Robinson & Fitter Forschungsresultate zur Frage des C-Transfers durch Wurzeln und Pilzmyzel.
Jedes Jahr pilgern über eine Million Menschen zur angeblichen Bleibe des Loch-Ness-Monsters in Schottland. Tausende suchen in einem See in der Grösse des Zürichsees nach Lebenszeichen des mythischen Tieres. Die Region nimmt dank diesem Marketingtraum jährlich über 100 Millionen Franken ein. Eva Oberholzer: Die grösste Suche nach dem Ungeheuer von Loch Ness seit 50 Jahren bringt neue Erkenntnisse: vier «gloops». Neue Zürcher Zeitung, 28.8.2023.
Jutzet N (2016) «Die Menschen brauchen Legenden», Interview von Prof. Volker Reinhardt. In: Freiburger Nachrichten vom 21.9.2016. www.freiburger-nachrichten.ch/grossfreiburg/die-menschen-brauchen-legenden
Michael Schmidt-Salomon : «Die Natur ist nicht gut». Neue Zürcher Zeitung, 30.8.2024. www.nzz.ch/folio/die-natur-ist-nicht-gut-und-der-mensch-nicht-boese-ld.1844851
Der Soziologieprofessor an der Université Paris-Diderot befasst sich mit der Art und Weise, wie sich im Alltag Legenden bilden. Bronner G (2021) L’empire des croyances. Paris: puf. 304 p.
Zu wissenschaftlichen Kontroversen um die Pflanzenneurobiologie: de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenneurobiologie
Nach Mischa Senn, Dozent für Medien- und Werberecht sowie Fachexperte und Vizepräsident der Schweizerischen Lauterkeitskommission, beschränkt sich die Verantwortung der Medien auf Wahrhaftigkeit und nur bedingt auf Wahrheit oder Richtigkeit. «Die Wahrhaftigkeit bezieht sich auf die subjektive Wahrnehmung, also auf das, was nach bestem Wissen und Gewissen persönlich für wahr gehalten wird.» Siehe NZZ vom 7.10.2024. Bei Verlagen ist diese Verantwortung juristisch nicht geregelt (M. Senn, pers. Mitt.).
Kaeser E (2018) Das gar nicht mehr so geheime intelligente Leben der Pflanzen. In: NZZ vom 14.3.2018.
Schmidt-Salomon M (2024) Das Konzept der Klimaneutralität ist zu kurz gedacht: Die Natur ist nicht gut – und der Mensch nicht böse. Neue Zürcher Zeitung, 30.8.2024. www.nzz.ch/folio/die-natur-ist-nicht-gut-und-der-mensch-nicht-boese-ld.1844851
Christian Ammer, Professor für Waldbau und Waldökologie an der Universität Göttingen, hat eine Petition mit 4500 Unterschriften aus Wissenschaft und Fachbehörden an Medien adressiert. Er bittet damit Journalisten, auch die Meinung von kritischen Wissenschaftlern einzuholen. Bei der nächsten Buchveröffentlichung von Wohlleben im Jahr 2017, hat es deutlich mehr Anfragen von Medienleuten bei Wissenschaftlern gegeben. Der Biologe Torben Halbe hat ein «Gegenbuch» geschrieben: «Das wahre Leben der Bäume» erklärt aus wissenschaftlicher Sicht, warum Bäume nicht schmecken, denken oder fühlen können.
Literatur
Das wahre Leben der Bäume: Ein Buch gegen eingebildeten Umweltschutz. Schmallenberg : WOLL-Verlag. 192 p.
Mother trees, altruistic fungi, and the perils of plant personification. Trends Plant Sci 29: 20–31. doi:https://doi.org/10.1016/j.tplants.2023.08.010
The magnitude and control of carbon transfer between plants linked by a common mycorrhizal network. J Exp Bot 50: 9–13. doi:https://doi.org/10.1093/jxb/50.330.9
The Secret Life of Plants. New York: Harper & Row. ISBN 0-06-091587-0. 402 p.
Evolution 2.0 – Macht und Ohnmacht des Homo sapiens». Berlin: wjs.
Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren. Die Entdeckung einer verborgenen Welt. München: Ludwig. 224 p.